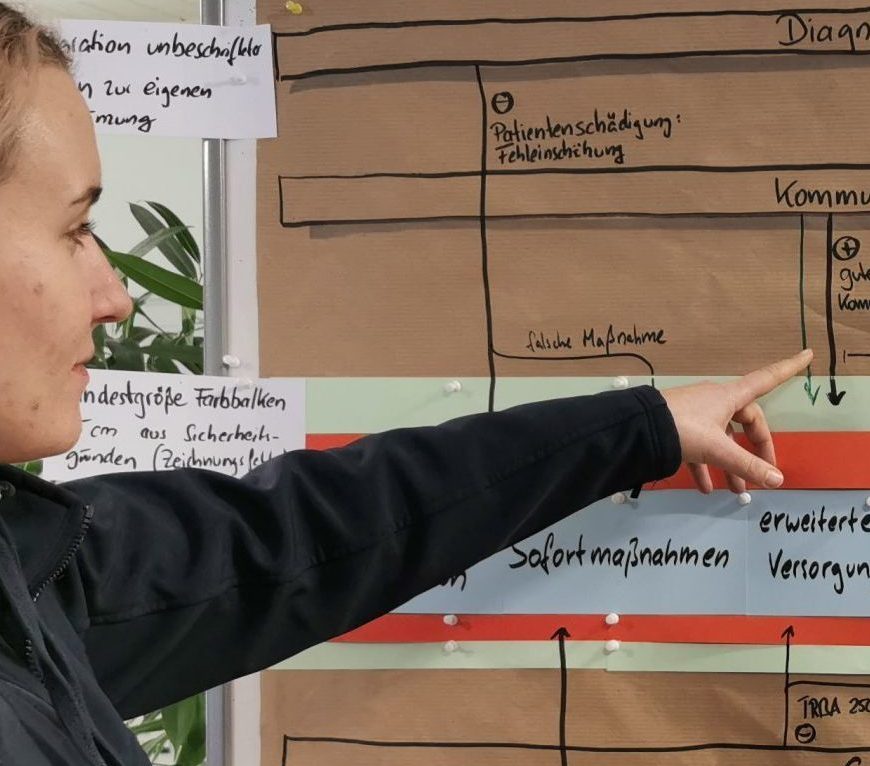Einleitung
Die Was? Ein Unterricht unterliegt nicht der Bedingungslosigkeit, sondern ist von einer ganzen Reihen von Faktoren abhängig. Es hat möglicherweise seinen Reiz, einen unbekannten Unterricht vor unbekannten SchülerInnen in einem unbekannten Raum zu halten, Doch könnte es sein, dass er dann nicht den eigenen oder fremden Ansprüchen genügt, oder auch nur ansatzweise die Anforderungen oder Zielsetzungen erfüllt. Für studentische Hausarbeiten ist die Analyse der Bedingungen meist fiktiv und ziemlich aufwendig. Berufsanfänger stellen nach dem Unterricht möglicherweise fest, dass sie manche Aspekte hätten vielleicht genauer unter die Lupe nehmen sollen. Realpädagogisch findet sich mit der Zeit und Erfahrung ein Mittelweg, denn viele der Analysepunkte haken Sie im Hinterkopf während Ihrer Detailplanung im vorbeigehen ab. Wenn Sie eine Bedingungsanalyse für Ihre Hochschule formulieren, schreiben Sie nur die für die aktuelle Planung wirklich relevanten Dinge auf. Alles andere ist Ballast. Dass Inga als Rechtshänderin momentan einen Gips am linken Arm hat, ist für einen Frontalunterricht wenig relevant. Für ein praktisches Reanimationstraining kann der Umstand Ihre Gruppenzusammensetzung beeinflussen und findet Einzug in die Niederschrift der Analyse. Je nach Anforderungen Ihrer Hochschule sollten Sie klären, in welchem Format Sie die einzelnen Fragen zu Papier bringen sollen. Für manche Bereiche (z.B. Gesetz und Lehrplan) eignet sich eine tabellarische Darstellung.
Bedingungen aus Gesetz und Lehrplan
Hier geht es um Vorgaben, auf die Sie kaum Einfluss nehmen können. Wir sprechen hier z B. vom NotSanG, der NotSan-APrV, einem Curriculum nach Ländervorgaben und/oder einem ggf. vorhandenen Schulcurriculum bzw. institutionelle Vorgaben. Folgende Leitfragen in Anlehnung an Prescher et al (2021, S.92f.) können Ihnen hier helfen:
- Gibt es gesetzliche Vorgaben auf Bundes- oder Länderebene, die beachtet werden müssen?
- Ist die zu unterrichtende Thematik im Schulcurriculum enthalten und wie ist sie dort verankert?
- Welchen Umfang hat die zu vermittelnde Thematik? Handelt es sich um eine komplette Unterrichtsreihe oder lediglich um einen Teil davon?Welcher zeitliche Rahmen ist vorgegeben?
- Falls vorhanden: Welche Zielsetzungen (Grob- oder Richtziele) sind für die Thematik definiert?
- Gibt es spezifische Vorgaben oder Standards, die für das Thema eingehalten werden müssen, wie z.B. Pflegestandards oder berufsgesetzliche Vorschriften?
- Welche Abhängigkeiten bestehen zu anderen Unterrichtsthemen oder Lehrkräften? Ist die Unterrichtsreihe/der Unterricht eigenständig oder in Bezug auf andere Themenbereiche eingebunden?
- Müssen bestimmte Inhalte vermittelt werden, weil andere Unterrichtsreihen darauf aufbauen? Beispielsweise Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Herzens im Hinblick auf die spätere Versorgung eines Herzinfarkts.
- Sind Verknüpfungen zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung möglich?
Bedingungen der Lernenden
Um den Unterricht optimal an die Bedürfnisse der Lernenden anzupassen, ist es unerlässlich, Informationen über die Lerngruppe zu sammeln. Wenn Sie Ihre eigene Klasse unterrichten, sind Ihnen diese Informationen möglicherweise bereits bekannt. Sobald Sie jedoch eine neue Klasse übernehmen oder eine Vertretung durchführen, werden diese Informationen besonders wichtig. Diese Informationen sind sowohl für die Unterrichtsplanung als auch für die Durchführung entscheidend. Nach Meyer (2018, S. 141) „[…] sollen Sie klären, ob die Schüler das, was sie tun sollen, überhaupt tun können“. In diesem Abschnitt der Bedingungsanalyse ermitteln Sie die Lernvoraussetzungen der Schüler. Es ist wichtig zu bedenken, dass Lernen ein Prozess ist, bei dem das Fehlen wesentlicher Komponenten das Erreichen der Lernziele gefährden könnte. An folgenden Leitfragen – adaptiert nach Esslinger-Hinz et. al. (2013, S. 60 ff.) – können Sie sich orientieren:
- Besitzen die Lernenden bereits Erfahrungen oder Vorkenntnisse im betreffenden Thema? Diese können sich in Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und persönlichen Kompetenzen manifestieren.
- Welche Formen der Zusammenarbeit im Unterricht sind den Lernenden bekannt (z. B. Gruppenarbeit oder Einzelarbeit)?
- Welche methodischen Fertigkeiten (z. B. Gruppenpuzzle, Brainstorming, IT-gestützte Lehrmethoden usw.) beherrschen die Lernenden bereits? Benötigen sie eine Einführung?
- Welche Lernstrategien und Arbeitsmethoden wenden die Lernenden bereits an? Sind SOL (Selbstorganisiertes Lernen) oder andere Lehr-Lernformate bekannt, oder bedarf es einer Einführung? CAVE: Gerade Formate wie das SOL bedürfen einer sorgfältigen Vorbereitung, es besteht die Gefahr des „SOL = Schule ohne Lehrkraft“)
- Welche generellen Fähigkeiten und Kompetenzen bringen die Lernenden mit? Dies betrifft kognitive, affektive und motorische Fähigkeiten. Reichen diese aus, um die Unterrichtsziele zu erreichen?
- Welche sozialen Fähigkeiten zeigen die Lernenden? Wie gehen sie miteinander um (z. B. Hilfsbereitschaft, Einhaltung von Regeln, Toleranz, Verlässlichkeit usw.)? Wie bewerten sie sich selbst (z. B. Selbstdisziplin, Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung)? Wie arbeiten sie zusammen (z. B. Kooperation, Kommunikation, Konfliktbewältigung usw.)?
- Gibt es Lernende, die durch besonderes soziales oder Lernverhalten auffallen?
- Gibt es soziokulturelle oder familiäre Aspekte, die beachtet werden müssen?
- Welche Lern- und Arbeitsgewohnheiten zeigen die Lernenden? Wie konzentriert arbeiten sie (z. B. Ausdauer, Disziplin usw.)? Zeigen sie Interesse und Motivation? Wie gehen sie mit Zeitdruck und Stress um? Wie selbstständig und verantwortungsbewusst arbeiten sie (z. B. Informationsbeschaffung, Selbstbewertung von Arbeitsergebnissen usw.)?
- Welche spezifischen Lernbedürfnisse haben die Lernenden? Diese könnten vor der nächsten Planung ermittelt werden.
- Welche Interessen und Erwartungen haben die Lernenden?
- Welche sprachlichen Fähigkeiten bzw. Textverständnis bringen die Lernenden mit?
Bedingungen der Lehrenden
Prescher et al. bringen es prägnant auf den Punkt, indem sie darauf hinweisen, dass es wichtig ist, sowohl die eigenen Stärken als auch Schwächen zu erkennen (Prescher et al., 2021, S. 94). So sollte geklärt werden, „was der eigene Bezug zum Thema ist“ (Prescher et al., 2021, S. 94). Ist das Thema vielleicht Neuland für mich oder habe ich es schon oft unterrichtet? Habe ich neben der Unterrichts- auch praktische Erfahrung aus dem Berufsleben (z. B. Kindernotfälle)? Oder habe ich mit dem Thema Probleme? Anm. des Autors: Ganz ehrlich? Mir liegt auch nicht jedes Thema gleich gut und ich bin manchmal froh, wenn ich ExpertInnen finde, die das Thema übernehmen können. Klappt das nicht, muss ich deutlich mehr Unterrichts- vorbereitung leisten. Aus den Impulsen von Prescher et al. (2021, S. 94) können folgende Leitfragen formuliert werden:
- Welche Erfahrung habe ich in der Planung von Unterrichtsreihen? (Einfluss auf das Zeitmanagement)
- Welche Erfahrung habe ich im Unterrichten im Allgemeinen? (Wie detailliert muss ich planen?)
- Bin ich mit dem Thema vertraut oder muss ich mich erst einlesen? Dies hat Auswirkungen auf den benötigten Zeitaufwand.
- Verfüge ich über praktische Erfahrung zum Thema, aus der ich schöpfen kann? Falls ja, wie sind meine Kompetenzen in Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz?
- Habe ich das Thema bereits zuvor unterrichtet?
- Habe ich einen persönlichen Bezug zum Thema? Dies betrifft auch meine persönliche Einstellung dazu. Ist es möglicherweise ein Thema, bei dem ich besonders viel Wissen oder Interesse habe, was jedoch bei der Sachanalyse und didaktischen Reduktion berücksichtigt werden muss, um relevante Inhalte zu priorisieren?
- Über welche Kompetenzen verfüge ich hinsichtlich der angewendeten Unterrichtsmethoden?
- Bin ich in der Lage, die geplanten Geräte zu bedienen, oder muss ich auf die Fähigkeiten anderer Teilnehmer vertrauen? Bin ich in alle Geräte ausreichend eingewiesen bzw. beherrsche ich den notwendigen Umgang damit (IT, Simulations- und Übungsmaterial)?
- Habe ich spezifische Vorlieben bezüglich der Unterrichtsmethodik oder Didaktik?
- Brauche ich Unterstützung und sollte eventuell Kollegen um fachliche, didaktische oder methodische Ratschläge bitten?
- Wie ist mein Verhältnis zu den Lernenden?
- Bin ich in alle Geräte ausreichend eingewiesen bzw. beherrsche ich den notwendigen Umgang damit? (IT, Übungsmaterial)
- Bin ich fit in den gewählten Methoden?
Bedingungen der Institution
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die relevanten örtlichen, zeitlichen und personellen Rahmenbedingungen der Institution oder Lernumgebung zu erfassen. Dennoch sollten Sie nicht davon ausgehen, dass alles unveränderlich ist. Möglicherweise können Sie einige Aspekte adaptieren, wie beispielsweise die Anordnung der Tische, um sie Ihren Bedürfnissen anzupassen.
- Leitfragen in Anlehnung an Esslinger-Hinz et al. (2013, S. 59 ff.) und Prescher et al. (2021, S. 93 ff.)
- Zeitplanung: In welchem Zeitraum findet der Unterricht statt? Vormittags? Nachmittags? Einflüsse durch zum Beispiel Temperaturen durch Sonneneinstrahlung?
- Lehrmittel/ Material: Welche Lehrmittel stehen zur Verfügung? Z.B. Anzahl funktionsfähige Übungspuppen, Verbrauchsmaterial
- Lernortbeschaffenheit und Einflüsse auf die Lernenden: Innen- oder Außenbereich? Wind (umherfliegende Papiermedien) Regen, Schnee, Eis (Rutschgefahr, für Kälteschutz sorgen), Sonneneinstrahlung (für Sonnenschutz sorgen), ggf. Mücken- und Zeckenschutz notwendig?
- Lernortkooperation: Bestehen nutzbare Lernortkooperationen?
- Räumliche Gegebenheiten: Wie viele Räume stehen in welcher Größe zur Verfügung? Bestuhlung (z. B.
für Gruppenarbeiten)? Bodenbelag (z. B. Flecken durch Kunstblut)? Ist eine rechtzeitige Raumbuchung notwendig? - Technische Infrastruktur: WLAN, Steckdosen, Beleuchtung der Räume (auch Möglichkeiten zum Abdunkeln bei Präsentationen), Präsentationsmedien (Flipcharts, SmartBoards, Tablets, Laptops, Dokumentenkamera, Beamer, Whiteboard usw.)
- Personelle Ressourcen: Wird Unterstützung durch andere Lehrkräfte / PraxisanleiterInnen oder ReferentInnen benötigt? An rechtzeitige Planung denken. CAVE: Plan B für Referentenausfall basteln
- Interaktionen mit anderen Klassen: Meist sind auch andere Klassen in der Nähe, hat dies Einfluss auf Ihren Unterricht (z.B. geteiltes Material, Lärm)
- Sicherheitsaspekte (Unfallgefahren, z.B. durch spitze Gegenstände, chemische oder biologische Arbeitsstoffe, Strom, Witterung)
- Pädagogisches Konzept: Gibt es ein zu beachtendes pädagogisches Schulkonzept oder Leitbild?
Literaturverzeichnis
Esslinger-Hinz, I., Wigbers, M. & Giovannini, N. (2013). Der ausführliche Unterrichtsentwurf (Pädagogik Praxis). Weinheim: Beltz.
Prescher, T., König, H. & Gabriel, O. (2021). Die Flamme des Lehrens. Pädagogisch-psychologische Grundlagen einer gelungenen Unterrichtsreihenplanung in den Gesundheitsberufen. Edewecht: Stumpf + Kossendey.
Meyer, H. (2018). Leitfaden Unterrichtsvorbereitung (9. Auflage.). Berlin: Cornelsen.

Lehrkraft an einer Berufsfachschule für NotfallsanitäterInnen
M.A. Berufliche Bildung im Gesundheitswesen
B.A. Berufspädagogik im Gesundheitswesen – Fachrichtung Rettungswesen
Notfallsanitäter mit mehr als 20 jähriger Berufserfahrung in der Land- und Luftrettung, u.a. als ltd. TC-HEMS und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst